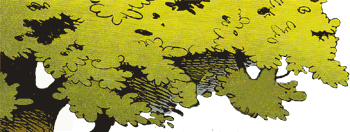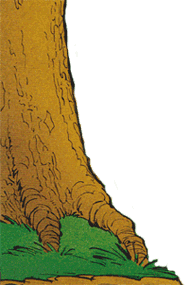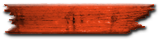Einleitung | Fische | Raufereien | Bezüge zur Historie

Fischfang in der Antike, römisches Mosaik, etwa 2. Jahrhundert
Die Fischerei der Eisenzeit spiegelt ein Spannungsfeld zwischen Alltagsnutzen, symbolischer Aufladung und humorvoller Brechung wider. Für die Kelten war der Fisch Lebensgrundlage und Prestigeobjekt, eingebettet in eine Welt voller Mythen und Rituale. Mit der Romanisierung verschob sich die Perspektive: Aus dem kultisch bedeutsamen Tier wurde ein alltägliches Produkt, das zugleich in Anekdoten und komischen Überlieferungen weiterlebte.
So lässt sich die Geschichte des Fisches von der Eisenzeit bis in die Spätantike als eine Bewegung zwischen drei Polen erzählen: Lebenswelt, Mythologie und Komik. Meine Inspiration zu diesem historischen Thema stammt von Jörg Nadler und seiner Homepage "Historischer Fischer". Dort gibt es nicht nur Informationen zur Fischerei der Eisenzeit, sondern viele weitere spannende Texte zur historischen und prähistorischen Fischerei.
Der Fisch in der keltischen Lebenswelt
Nahrung und Alltag
In der keltischen Gesellschaft spielte der Fisch eine bedeutende, wenn auch regional unterschiedlich gewichtete Rolle. Während in manchen Gebieten Ackerbau und Viehzucht im Vordergrund standen, nutzten andere Gemeinschaften die Gewässer intensiv. Besonders in Binnenregionen belegen archäologische Funde, dass Fischerei keineswegs nebensächlich war. Reusen, Fischzäune, Netze und Angeln zeigen, dass sich die Kelten sehr genau mit den Lebensgewohnheiten der Fische auskannten.
Die Vielfalt der Fangmethoden – von einfachen Schlaghaken über Querangeln bis zu komplexen Netzanlagen – spiegelt nicht nur praktisches Wissen wider, sondern auch die Fähigkeit, Techniken an Landschaft und Jahreszeiten anzupassen. Hechte wurden etwa während der Laichzeit mit Speeren und Schlingen gefangen, während Reusen oder Fischzäune für den Fang über längere Zeiträume genutzt werden konnten.
Besonders eindrucksvoll sind die Funde am Federsee oder in Oberdorla. Dort ließen sich Dutzende Reusen und Netze nachweisen, was eine intensive, fast schon professionelle Nutzung selbst kleiner Seen belegt. Fisch war somit Teil der Grundversorgung, diente als Ergänzung zur Ernährung mit Getreide, Fleisch und Milchprodukten und konnte in Überschusszeiten auch getauscht oder verkauft werden.
Technik und Handwerk
Die Gerätschaften bestanden größtenteils aus vergänglichen Materialien wie Holz, Bast, Weidengeflecht oder Knochen. Nur selten finden sich Metallteile, etwa Angelhaken oder Speerspitzen. Diese Einfachheit täuscht jedoch über die Raffinesse hinweg: Jede Falle, jedes Netz beruhte auf genauen Kenntnissen über Verhalten, Wanderungen und Laichplätze der Fische. So zeigt die Stülpe – ein korbartiges Fanggerät – wie einfach und zugleich effektiv Fischerei sein konnte. Mit ihr fing man Köderfische im Flachwasser, die später für die Raubfischjagd gebraucht wurden. Komplexer waren Netze oder Fischzäune, die nicht nur handwerkliches Geschick erforderten, sondern auch Kooperation in der Gemeinschaft.
Soziale Dimension
Fischfang war nicht nur Sache der Bauernfamilien. Während manche nur saisonal auf Fisch zurückgriffen, gab es auch spezialisierte Fischer, die das ganze Jahr über tätig waren. Archäologische Nachweise von Netzsenkern, Filetnadeln oder großflächigen Fischzäunen lassen auf eine Arbeitsteilung schließen. Darüber hinaus konnte Fischerei eine Freizeitbeschäftigung für wohlhabende Personen sein. Hinweise auf „Liebhaberangeln“ bei keltischen Fürsten zeigen, dass Fische nicht allein Nahrung, sondern auch Objekte von Prestige und Vergnügen waren.
Fisch und Mythologie
Symbolische Bedeutung des Fisches
Der Fisch war in der keltischen Welt nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern auch ein Symbol. Gewässer galten als Übergangsräume zwischen den Welten, als Orte der Opferung und der Kommunikation mit dem Göttlichen. Fische, die in diesen Gewässern lebten, erhielten damit eine mythische Aufladung.
In vielen Kulturen Europas steht der Fisch für Fruchtbarkeit, Erneuerung und Überfluss. Gerade der Hecht, der in zahlreichen keltischen Gewässern vorkam, hatte durch seine Größe und sein räuberisches Wesen eine besondere Stellung. Er konnte sowohl Nahrung als auch Gefahr symbolisieren.
Fische in Opferpraktiken
Moor- und Seeheiligtümer, wie das in Oberdorla, zeigen, dass Fische Teil ritueller Handlungen waren. Dort fanden sich nicht nur Fanggeräte, sondern auch Fischreste in kultischen Kontexten. Diese Belege deuten darauf hin, dass Fische geopfert oder als rituelles Mahl dargebracht wurden.
Die Verbindung von Fisch und Ritual zeigt sich auch im römischen Bereich, wo bestimmte Fischarten als Opfergaben an Götter galten. Bei den Kelten lässt sich diese Praxis zwar weniger klar nachweisen, doch die Symbolik des Wassers und die Funde in Heiligtümern legen nahe, dass Fischerei mehr als nur Ernährung bedeutete.
Fische als Grenzgänger
Mythologisch betrachtet verkörperte der Fisch den Übergang: zwischen Leben und Tod, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Natur und Kultur. Ein im Wasser lebendes Wesen, das dennoch Nahrung für den Menschen liefert, passte ideal in die keltische Welt, die Übergänge und Dualitäten besonders betonte.Von der Mythologie zur Komik
Vom Kultobjekt zum Alltagsgegenstand
Während der Fisch in der religiösen Symbolik mächtig aufgeladen war, wurde er im Alltag auch zum Gegenstand der Ironie. Mit der Romanisierung und der Verschriftlichung keltischer Mythen begann ein Prozess der Transformation: Der ehrwürdige Fisch aus den Kultstätten wurde zunehmend Teil alltäglicher Geschichten, Anekdoten und später sogar Spott.
Humorvolle Perspektiven
Römische Autoren beschrieben germanische und keltische Fischerei teils mit einem Unterton von Herablassung. Für sie war der mühsame Fang in Seen und Mooren ein primitiver Gegensatz zur kultivierten römischen Aquakultur mit Teichanlagen und luxuriösen Fischbecken. Dass Germanen etwa mit Schlaghaken oder improvisierten Schlingen Hechte fingen, wurde leicht als „barbarisch“ belächelt.
Auch die Römer selbst entwickelten komische Erzählungen um den Fisch. Während Aquakulturen wie die Haltung von Muränen in Luxusvillen Statussymbole waren, kursierten Anekdoten über Besitzer, die ihre Tiere schmückten, benannten oder gar beweinten. Der Fisch wurde vom Symboltier zum „Haustier“, das Anlass zu Spott und Übertreibung bot.
Von der Symbolik zur Satire
Die Wandlung vom mythologisch verehrten Fisch zum Gegenstand humoristischer Betrachtung zeigt, wie Kultur sich verändert. Wo der Fisch einst Opfergabe und Sinnbild von Fruchtbarkeit war, konnte er nun auch Stoff für Anekdoten und Komik liefern. Diese Entwicklung markiert nicht nur den Einfluss der römischen Kultur auf die keltische Welt, sondern auch den Beginn einer literarischen Tradition, in der der Fisch in Witzen, Karikaturen und Satiren weiterlebte.